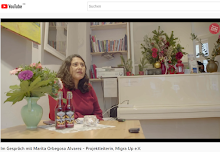El viernes vi varias llamadas perdidas de mi esposo. Cuando quise devolverle la llamada, aparecieron varias fotos en el chat de WhatsApp: policías y bomberos. El sótano de nuestro edificio había empezado a incendiarse. Les transeúntes vieron el fuego y llamaron a la policía. Mi marido había estado allí apenas media hora antes y, por suerte, no había llamas ni nada fuera de lo normal. No era muy tarde, pero sí lo suficiente como para notar que algo no andaba bien. Cuando salió al balcón, vio el fuego y dio aviso, aunque la gente ya estaba alertada. Todo pudo controlarse a tiempo.
No podía dejar de imaginar qué habría pasado si esto ocurría de madrugada. El fuego podría haber invadido todos los pisos y quizá no habría sido posible contenerlo.
Al inicio parecía que tendríamos que buscar otro lugar para dormir. Media hora después nos dijeron que, parcialmente, todo estaba bajo control: podíamos entrar, pero el olor a quemado estaba por todas partes. No había calefacción ni gas. La electricidad funcionaba, pero no había agua caliente, y tocaba adaptarse al frío. Por suerte, como acampamos mucho, teníamos reservas: calefacción portátil para un par de habitaciones, un absorbedor de humedad y olores, y una máquina para cocinar y hornear que no necesita gas. Empezamos a reorganizar todo en casa y ahora solo queda adaptarse.
No tenemos noticias de cuándo se recuperará la normalidad, pero hay que acostumbrarse. Como peruana, recordé las veces en que nos racionaban el agua y teníamos que bañarnos con un jarrito, calentando el agua en invierno. Esos recuerdos me ayudaron mucho y, curiosamente, los vivo hoy con cariño y nostalgia.
Ahora toca vivir un poco como muchos de nuestros colegas humanos en distintas partes del mundo: vivir sin quejarnos, confiando en que todo se va acomodando. No depende tanto de que el sistema vuelva a funcionar como antes, sino de nuestra disponibilidad para adaptarnos y, en medio de todo, aprender. Al día siguiente tocaba retomar lo que habíamos dejado pendiente. Y aun con todo, la comida me supo como la mejor del mundo, sin necesidad de ir a un restaurante.
Por la noche había una invitación especial: una querida amiga —mentora clave cuando decidí vivir en Alemania— cumplía años. Lucia Muriel, psicóloga ecuatoriana, celebraba junto a otra compañera. Fue hermoso olvidarme del estrés de las horas anteriores. Fui con mi esposo. Fue lindo conocer gente nueva y reencontrarme con caras conocidas. Aun con tanto barullo, la fiesta se hacía sentir.
Ah, las emociones… vienen y van. Es importante reconocerlas y dejarlas estar.
Me alegró tanto ver a Lucia, tan jovial y bella como siempre. Este tiempo reaviva nuestra amistad y quizá también muchas alianzas posibles para el futuro.
** Incluso en la incertidumbre, la vida insiste en recordarnos que estamos acompañadas, que sabemos adaptarnos y que siempre hay espacios para celebrar, agradecer y seguir caminando.
++++
Das Leben überrascht mich immer wieder – auf die gute Art.
Am Freitag sah ich mehrere verpasste Anrufe von meinem Mann. Als ich zurückrufen wollte, erschienen mehrere Fotos im WhatsApp-Chat: Polizei und Feuerwehr. Der Keller unseres Gebäudes hatte Feuer gefangen.
Passant:innen bemerkten den Brand und alarmierten die Polizei. Mein Mann war etwa eine halbe Stunde zuvor noch dort gewesen, und glücklicherweise gab es zu diesem Zeitpunkt weder Flammen noch etwas Auffälliges. Es war nicht sehr spät, aber spät genug, um zu merken, dass etwas nicht stimmte. Als er später auf den Balkon ging, sah er das Feuer und meldete es – zu diesem Zeitpunkt waren jedoch bereits alle informiert. Alles konnte rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden.
Unwillkürlich stellte ich mir vor, was passiert wäre, wenn dies mitten in der Nacht geschehen wäre. Das Feuer hätte sich auf alle Stockwerke ausbreiten können, und vielleicht hätte man es nicht mehr eindämmen können.
Zunächst sah es so aus, als müssten wir uns einen anderen Schlafplatz suchen. Eine halbe Stunde später hieß es dann, dass die Situation teilweise unter Kontrolle sei: Wir konnten wieder hinein, doch der Brandgeruch war überall. Es gab weder Heizung noch Gas. Der Strom funktionierte, aber es gab kein warmes Wasser, und wir mussten uns an die Kälte anpassen.
Zum Glück sind wir viel campen gegangen und hatten vorgesorgt: eine mobile Heizung für ein paar Zimmer, einen Feuchtigkeits- und Geruchsabsorber sowie ein Koch- und Backgerät, das kein Gas benötigt. Wir begannen, alles neu zu organisieren, und nun heißt es vor allem: anpassen.
Wir wissen noch nicht, wann wieder Normalität einkehrt, aber wir lernen, damit zu leben. Als Peruanerin erinnerte ich mich an Zeiten, in denen das Wasser rationiert war und wir uns im Winter mit einem kleinen Becher wuschen, nachdem wir das Wasser erhitzt hatten. Diese Erinnerungen halfen mir sehr – und heute empfinde ich sie sogar mit einer gewissen Zärtlichkeit und Nostalgie.
Jetzt heißt es, ein wenig so zu leben wie viele unserer menschlichen Weggefährt:innen in anderen Teilen der Welt: ohne Klagen, im Vertrauen darauf, dass sich alles allmählich ordnet. Es hängt weniger davon ab, dass das System wieder so funktioniert wie früher, sondern vielmehr von unserer Bereitschaft, uns anzupassen – und unterwegs zu lernen.
Am nächsten Tag ging es darum, das wieder aufzugreifen, was wir liegen gelassen hatten. Und trotz allem schmeckte mir das Essen wie das beste der Welt – ganz ohne Restaurantbesuch.
Am Abend folgte eine Einladung: Eine liebe Freundin, eine wichtige Mentorin in der Zeit, als ich mich entschied, in Deutschland zu leben, hatte Geburtstag. Lucia Muriel, eine ecuadorianische Psychologin, feierte gemeinsam mit andere Weggefährtin. Es tat gut, den Stress der vergangenen Stunden hinter mir zu lassen. Ich ging mit meinem Mann. Es war schön, neue Menschen kennenzulernen und vertraute Gesichter wiederzusehen. Trotz des Trubels war die Feier deutlich spürbar.
Ach, die Emotionen … sie kommen und gehen. Wichtig ist, sie wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben.
Es freute mich sehr, Lucia zu sehen – so lebendig und schön wie immer. Diese Zeit belebt unsere Freundschaft neu und vielleicht auch viele mögliche Bündnisse für die Zukunft.
*** Selbst in Momenten der Unsicherheit erinnert uns das Leben daran, dass wir nicht allein sind, dass wir anpassungsfähig sind und dass es immer Raum gibt zum Feiern, zum Dankbar sein und zum Weitergehen.